Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Geeint für die Menschlichkeit - Namensbeitrag von Außenministerin Annalena Baerbock
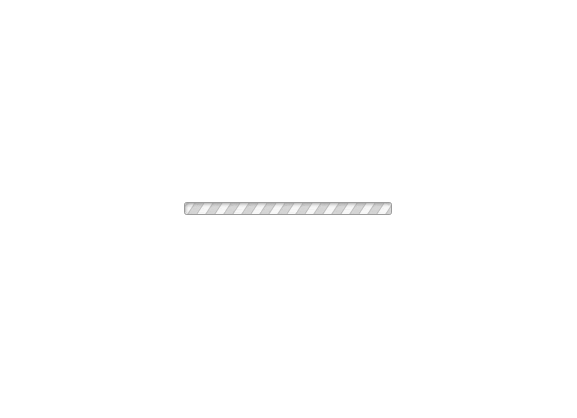
Aktuell, 03.11.2022, Muenster, Annalena Baerbock Aussenministerin der Bundesrepublik Deutschlandim Portrait bei der Paneldiskussion beim Deutsch-Amerikanisches Zukunftsforum 2022, © Flashpic
Wie können wir zuversichtlich in das Jahr 2023 gehen? Ein neues Jahr beginnt und auf dem europäischen Kontinent tobt ein verheerender Krieg. Russlands Angriffskrieg reißt Wunden, die weit über Europa hinaus schmerzen: Er verschärft die Energie- und Ernährungskrise in weiten Teilen Afrikas, des Nahen Ostens und Asiens. Jeden Abend gehen mehr als 800 Millionen Männer, Frauen und Kinder hungrig zu Bett. Befeuert wird dieses Leid durch die Klimakrise, die weltweit Konflikte anheizt und Menschen ihrer Landflächen, ihrer Heimat und ihrer Sicherheit beraubt.
Wie können wir optimistisch sein, in diesen schlimmen Zeiten der Unsicherheit? Ich bin der festen Überzeugung, dass uns, die wir weltweit Führungsverantwortung tragen, gar nichts anderes übrigbleibt, als dem neuen Jahr mit der festen Zuversicht zu begegnen, dass wir Veränderungen anstoßen können, um das Leben der Menschen zu verbessern. Nicht trotz, sondern gerade wegen der geballten Wucht dieser Krisen.
Nelson Mandela hat die Momente, in denen sein Glaube an die Menschheit auf die Probe gestellt wurde, aber in denen er dennoch der Verzweiflung nicht nachgegeben hat, einmal so beschrieben: „Zum Optimistisch-Sein gehört, das Gesicht der Sonne zuzuwenden und immer vorwärts zu gehen.“
Nach vorn schauen und Kurs halten, im Vertrauen auf das, was wir erreichen können, wenn wir zusammenstehen – das, denke ich, sollte uns ins kommende Jahr leiten. Und das sage ich nicht aus einem naiven Gefühl der Hoffnung heraus. Ich sage es mit dem Selbstvertrauen einer Außenministerin, die im Verlauf der vergangenen 12 Monate in vielen – oft schwierigen – Situationen gelernt hat, wie viel wir erreichen können, wenn wir uns in unserem Tun von Solidarität und Menschlichkeit leiten lassen und verteidigen, woran wir glauben.
Und ganz genau so haben wir auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert: geeint, als Europäerinnen und Europäer, über den Atlantik hinweg und weltweit; mit unserer klaren Haltung gegen die Unmenschlichkeit des Krieges, mit unserer Unterstützung für die Ukraine, mit Sanktionen, die sich gegen die russische Kriegsmaschinerie richten, und mit Investitionen in unsere Sicherheit.
Diese außergewöhnliche Einigkeit war nicht selbstverständlich. Auf der VN-Generalversammlung im März haben mehr als 140 Staaten gegen die russische Aggression ihre Stimme erhoben – Staaten des Nordens wie des Südens, des Ostens wie des Westens; alle unterschiedlich in ihrem geschichtlichen, politischen und kulturellen Hintergrund. Geeint hat uns die gemeinsame Sache – das zu tun, was unsere Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten: unmissverständlich klarzumachen, dass wir uns in Situationen des Unrechts nicht neutral verhalten werden. Wir werden Partei ergreifen für die Gerechtigkeit – Gerechtigkeit für die vergewaltigte Frau in Butscha, den erschossenen Dirigenten in Cherson und das Kleinkind, das aus seinem Zuhause in der Ostukraine vertrieben wurde.
Denn wir könnten an ihrer Stelle sein, so wie sie an unserer. Ließen wir diesen Angriffskrieg einfach so geschehen, so könnte nirgendwo mehr jemand ruhig schlafen – aus der Angst heraus, von seinem größeren Nachbarn angegriffen zu werden.
Unsere Stärke liegt in unserer Einigkeit. Geeint für die Menschlichkeit – diese tiefe Überzeugung gibt mir Zuversicht für das vor uns liegende Jahr.
Dafür müssen wir besser zuhören. Das ist eine weitere ganz entscheidende Lehre, die ich aus den Ereignissen der letzten Monate gezogen habe – nicht nur in Bezug auf unsere Partner in Europa, sondern auch auf jene in Afrika, Asien und Lateinamerika sowie im Nahen und Mittleren Osten.
Wenn ich mit vielen dieser Partner über Russlands Krieg gesprochen habe, dann habe ich oft gehört: „Ihr wollt, dass wir an eurer Seite stehen, jetzt, wo es Krieg in Europa gibt. Aber wo wart ihr in den letzten Jahren, als wir schmerzhafte Konflikte durchlebt haben?“
Diese Sorge verstehe ich. Und ich glaube in der Tat, dass wir bereit sein sollten, unser eigenes Handeln, unser früheres Engagement in der Welt auch kritisch zu hinterfragen. Wir sollten auch aufmerksam zuhören, wenn unsere Partner uns berichten, wie schwierig es für sie ist, weniger abhängig von Russland zu werden – militärisch, politisch oder wirtschaftlich. Das ist eine enorme Herausforderung. In Deutschland sehen wir, wie die Kosten für die Überwindung unserer Abhängigkeit unsere Bürgerinnen und Bürger belasten. Für viele Partner sind die Einschnitte noch schmerzhafter, und ihnen ist es schlicht unmöglich, einen milliardenschweren Abwehrschirm aufzuspannen.
Unsere Partner müssen wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Ein Amtskollege sagte kürzlich: „Wir brauchen engagierte Partner und keine Partner, die uns nur nach dem Mund reden.“ Dieser Grundsatz sollte uns leiten.
Unsere klare Botschaft ist, dass wir der Welt nicht den Rücken zukehren, weil in unserer Nachbarschaft ein Krieg tobt. Im Gegenteil: Wir sehen, wie eben dieser Krieg Leid über die ganze Welt bringt, weil Russland den Zugang zu ukrainischen Getreideausfuhren beschränkt und Lügen darüber verbreitet, wer die Schuld an den Engpässen trägt.
Unsere Reaktion war immer dann am wirksamsten, wenn sie geschlossen war. Es waren die Vereinten Nationen, die gemeinsam mit unseren türkischen Partnern die Öffnung der ukrainischen Getreidehäfen ausgehandelt haben. In der Gruppe der Sieben, die die wirtschaftlich stärksten Demokratien versammelt, hatten wir bis Juni 2022 mehr als 14 Milliarden US‑Dollar zugesagt, um die Not derjenigen zu lindern, die am meisten leiden. Und Deutschland bleibt der zweitgrößte Geber humanitärer Hilfe weltweit. Es ist diese Solidarität, die mich zuversichtlich stimmt. Aber sie allein reicht nicht.
Wenn wir etwa sehen, wie das Welternährungsprogramm gezwungen war, Lebensmittelrationen zu kürzen, in Jemen, in Somalia, im Sahel. Hinter jeder gekürzten Portion steht ein hungriges Kind. Und wenn Sie Ihr Kind hungern sehen, dann können Sie nur schwer für Demokratie, Recht und Freiheit kämpfen. Deswegen dürfen wir in unserer gemeinsamen Unterstützung nicht nachlassen, auch mit Blick auf das nächste Jahr.
Gleichzeitig werden wir unsere Partner zusammenbringen, um eine der schwerwiegendsten Ursachen der Ernährungskrise anzugehen – die Klimakrise. Für Millionen Menschen überall auf der Welt ist diese Krise eine konkrete Gefahr für ihre Existenz, für ihr Leben. Frauen im Norden Malis haben mir berichtet, wie Dürren ihre Ernten vernichten, wie sich Konflikte um Land und Rohstoffe verschärfen, wie Bäuerinnen keine andere Möglichkeit sehen, als ihre Heimat zu verlassen. In Palau habe ich mit einem Fischer am Strand gestanden, der mir gezeigt hat, wie steigende Meeresspiegel drohen, sein Haus zu zerstören – in weniger als zehn Jahren. Sein Zuhause, seine Sicherheit, seine Lebensgrundlagen.
Auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, der COP 27, sagte mir eine Aktivistin aus Tschad: „Während wir reden, steht mein Land unter Wasser, meine Mutter, meine Schwestern und meine Cousinen haben ihr Zuhause verloren.“
Die Klimakrise verursacht Leid, sie vertreibt, sie tötet. Sie ist eine unmittelbare Bedrohung des menschlichen Lebens.
Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Staaten wie Tschad und Palau so massiv unter dieser Krise leiden, obwohl sie so gut wie nichts zu ihrer Entstehung beigetragen haben.
Als Industrieländer, die wir die Hauptschuld an der Krise tragen, kommt uns eine besondere Verantwortung dabei zu, sie zu mindern, Emissionen zu senken und dafür zu sorgen, dass das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite bleibt. Denn jedes Zehntelgrad, um das die Erde sich weniger erwärmt, bedeutet weniger starke Stürme, Fluten oder Dürren – und damit mehr Sicherheit.
Deshalb war es so wichtig, dass wir auf der COP 27 ein neues Kapitel der Klimagerechtigkeit aufgeschlagen haben. Jetzt ist es an den großen Treibhausgasemittenten, ihren Anteil für die Klima-Schäden und -Verluste zu zahlen, die sie in den verwundbarsten Ländern verursachen. Dabei geht es nicht um Wohltätigkeit; es geht um Gerechtigkeit. Insbesondere kleine Inselstaaten haben dies jahrzehntelang gefordert – und zwar zu recht. Dieses Jahr haben wir endlich das klare Signal gesendet: Wir haben euch gehört. Wir haben verstanden. Und jetzt handeln wir.
Beim Klimanotstand wie in anderen Konflikten und Krisen sind es die Schwächsten, die am meisten leiden: Frauen, Kinder, Ältere, marginalisierte Gruppen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Rechte von Frauen ein Gradmesser sind für den Zustand unserer Gesellschaften. In autokratischen Regimen sind es diese Rechte, die oft zuerst wegbrechen. Wenn das geschieht, ist das ein Signal, dass mit noch Schlimmerem zu rechnen ist. Was autokratische Regime am meisten fürchten, sind Frauen, die ihre Stimme erheben.
Keine Gesellschaft, keine Volkswirtschaft kann erfolgreich sein, wenn die Hälfte der Bevölkerung unterdrückt wird. Deswegen ist für die Bundesregierung eine feministische Außenpolitik, die gleiche Rechte für jede und jeden von uns in unseren Gesellschaften fördert, ein Kernaspekt harter Sicherheit. In unserer Nationalen Sicherheitsstrategie, die wir gegenwärtig erarbeiten, wird sie ein zentrales Element sein.
„Frauen sind die ersten Opfer eines Krieges, aber nur sie verfügen über den entscheidenden Schlüssel zum Frieden.“ So formulierte es die kongolesische Menschenrechtsaktivistin Julienne Lusenge.
„Wenn Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher“, so haben es mir mutige Frauen in der Ukraine gesagt.
„Frauen. Leben. Freiheit.“, skandieren die Frauen in Iran. Überall auf der Welt hallt ihr Ruf als Hymne des Mutes wider.
Wenn ich Kraft für 2023 schöpfen soll, dann finde ich sie bei all diesen tapferen Frauen, ob sie nun aus Kongo, Iran, Afghanistan oder der Ukraine kommen.
Ihr Ruf ist unsere Hymne. Ihr Mut ist unser Gradmesser. Ihre Sache ist uns Verpflichtung – nicht nur zuversichtlich zu sein, sondern mutig zu handeln: geeint für die Menschlichkeit